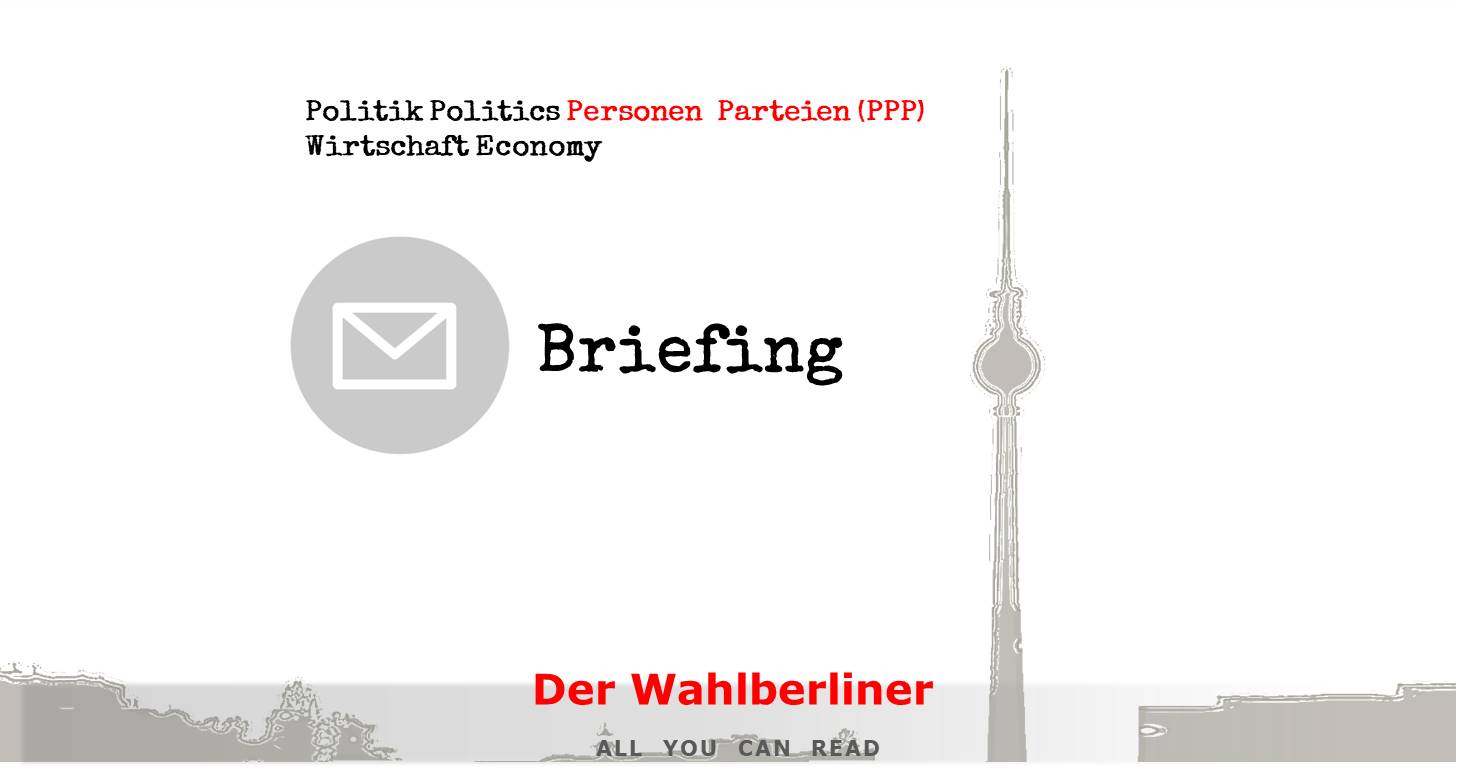Briefing 250 | PPP | Politik, Personen, Parteien
Unser 250. Briefing ist kein außergewöhnliches, allerhöchstens ist es besonders kurz. Es beinhaltet Basiswissen über die Demokratie in Deutschland. In Westdeutschland, bis 1990. Aus naheliegenden Gründen wurden nicht die Ergebnisse von Volkskammerwahlen in der DDR zum Vergleich abgebildet. Ein aktueller Anlass, gerade jetzt diesen Rückblick zu veröffentlichen, besteht aber doch. Jüngste Umfragen melden die AfD bei 22 Prozent. 2021 erhielt sie noch 10,3 Prozent der Stimmen.
Die Entwicklung der Sitzverteilung im Deutschen Bundestag spiegelt die Veränderungen im deutschen Parteiensystem wider. Wie die Statista-Animation anschaulich demonstriert, dominierten in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg drei Parteien das politische Geschehen: CDU/CSU, SPD und FDP. Nur im Jahr 1949 gab es eine Ausnahme, als die Fünfprozenthürde nicht bundesweit galt und elf Parteien ins Parlament einzogen.
Mit der Gründung der Grünen im Jahr 1980 begann eine neue Phase der Parteienvielfalt. Die ökologische Partei schaffte 1983 erstmals den Sprung über die Fünfprozenthürde und etablierte sich als vierte Kraft im Bundestag. Ab 1990 kam eine weitere Partei hinzu: Die PDS, die spätere Linke, die vor allem in Ostdeutschland erfolgreich war. Die AfD trat nach der Bundestagswahl 2017 als siebte Partei in den Bundestag ein, nachdem sie 12,6 Prozent der Stimmen erhielt.
Die Animation zeigt auch, wie stark die Stimmenanteile der Union und der SPD in den letzten Jahren gesunken sind. Dies wird von vielen Beobachtern als Zeichen einer abnehmenden Bindungskraft der ehemaligen Volksparteien gedeutet, die mit dem Wandel von Werten, Lebensstilen, Weltanschauungen, Diversität und Pluralismus in der Gesellschaft zusammenhängt. Dadurch entstehen differenziertere politische Präferenzen, die von kleineren Parteien wie den Grünen, der FDP und der AfD stärker aufgegriffen werden.
Zusammenfassung mit ChatGPT (Verfassen)
Ein viel diskutiertes Problem in der jüngsten Vergangenheit ist die stetige Vergrößerung des Bundestags. Eine Folge davon: Die Kosten für das Personal des Deutschen Bundestags haben sich seit dem Jahr 2005 verdoppelt. Nach einer scharfen Kontroverse im Bundestag hat die Ampelkoalition im März 2023 ihre umstrittenen Pläne für eine Wahlrechtsreform zur Reduzierung der Abgeordnetenzahl mit 399 Ja- bei 261 Nein-Stimmen und 23 Enthaltungen durch das Parlament gebracht. Mit der Neuregelung wollen die Koalitionsfraktionen die Zahl der Bundestagsmandate künftig verlässlich auf 630 begrenzen. Dazu sehen sie einen Verzicht auf die bisherige Zuteilung sogenannter Überhang- und Ausgleichsmandate vor. (Schlussabsatz des Statista-Textes zur Grafik)
Wir werden künftig häufiger Racing Bars implementieren, aber Sie sollten sich natürlich nicht mit den in diesem Fall nur wenige Sekunden langen Laufgrafiken begnügen, sondern auch die Texte dazu lesen.
Für uns war das auch eine Zeitreise an einem „elegischen Sonntag“, zu dessen Stimmung diese Fahrt in die Vergangenheit (bzw. aus ihr heraus in die Gegenwart) sehr gut passt. Wir haben das Dreiparteiensystem noch miterlebt, denn die erste Bundestagswahl, die wir bewusst wahrgenommen haben, war die des Jahres 1976. Seitdem ist unglaublich viel passiert. So ein langer Lebensweg. Und an so vielen Wahlen auf Bundes- und Landesebene haben wir teilgenommen, nur eine einzige verpasst. Das war die Abwahl von Kanzler Schröder und der Beginn der Ära Merkel. Wir wollten damals, kurz vor dem Sprung ins Ausland, die Verhältnisse in Deutschland nicht mehr beeinflussen, und sei es nur durch zwei Stimmen einer einzelnen Person (die Erst- und Zweitstimme bei einer Bundestagswahl).
Demnächst könnte sogar ein Siebenparteiensystem entstehen, falls es zur Gründung einer Wagenknecht-Partei kommt. Die Frage ist allerdings, ob dann die Linke als Dauergast im Bundestag erhalten bleibt.
Und doch gibt es eine große Kontinuität im deutschen Politikbetrieb seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zumindest den Westen betreffend. Gleichzeitig erfahren wir, dass die Fragmentierung der Lebensstile und Milieus mit einer beinahe zwingend erscheinenden Logik eine Spiegelung in der Entwicklung des Parteiensystems erfährt. Allerdings heißt das nicht, dass mit dem größeren Parteienangebot auch mehr Menschen eine Zufriedenheit mit der Demokratie empfinden. Vielleicht sind sie anspruchsvoller geworden, vielleicht ist aber auch der Zwang zum Kompromiss in Koalitionen mit immer mehr Parteien so groß, dass die Unterscheidbarkeit darunter leidet. Oder es läuft wie bei der aktuellen Ampelkoalition, wo es immer wieder zu erheblichen Reibungen kommt, weil das Ungleiche irgendwie in Regierungsarbeit gegossen werden muss. Dennoch fehlt vielen eine Alternative. Daran hat auch die AfD nichts geändert, die besonders Menschen, denen eine starke Linke in Deutschland fehlt, verständlicherweise nicht als Alternative begreifen werden.
Nach unserer Ansicht kommt es weniger auf die Zahl der Parteien an als darauf, dass deren Repräsentant:innen glaubwürdig wirken. Wenn sie diese Wirkung erzielen und zudem nicht spaltend, sondern vereinigend auftreten, sind nach unserer Ansicht auch wieder Ergebnisse von mehr als 30 Prozent der Stimmen möglich. Ob es einmal wieder an absolute Mehrheiten heranreichen wird, wie sie die CDU einmal und zwei weitere Male beinahe eingefahren hat? Wohl eher nicht. Es sei denn, es käme zu der nicht erwartbaren Situation, dass eine Persönlichkeit so glaubwürdig wirkt und gleichzeitig so vereinend, dass sie eine Mehrheit der Menschen hierzulande hinter sich bringt.
Was wir gelernt haben (man lernt immer etwas dazu): Dass es 1949 die 5-Prozent-Hürde noch nicht gab. Wir hatten es so im Kopf, dass sie schon im GG geregelt war, als es am 23.05.1949 in Kraft trat. Immerhin, das Datum mussten wir nicht googeln.
TH
Entdecke mehr von DER WAHLBERLINER
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.