Filmfest 662 Cinema
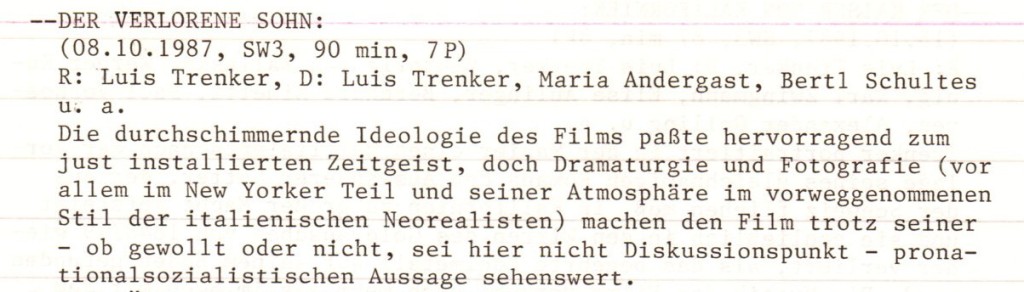
Das große Personenlexikon des Films nannte Der verlorene Sohn ein „erdverbundenes Heimat-Drama“[7] und schrieb weiters über den Film: „Die Geschichte eines jungen Mannes (Trenker), der seine Alpenheimat verläßt, um sein Glück in Amerika zu suchen, angesichts der dortigen Massenarbeitslosigkeit scheitert und schließlich reumütig wieder nach Hause, in die Berge, zurückkehrt, war bei den neuen braunen Machthabern vor allem wegen ihrer intensiven Religiosität nicht allzu wohlgelitten.“[5]
Der Film ging unter dem Arbeitstitel Sonnenwend in Planung. Es war die letzte deutsche Produktion der deutschen Dependance der Hollywood-Produktionsfirma Universal Film und zugleich die letzte Produktionstätigkeit des im Deutschen Reich Adolf Hitlers nicht mehr wohlgelittenen Juden Paul Kohner.
Am 1. November 1933[4] schiffte sich Trenker in Cherbourg mit dem deutschen Fahrgastschiff Bremen nach New York ein, um in den kommenden Wochen mit versteckter Kamera die für Der verlorene Sohn benötigten dokumentarischen Straßenimpressionen aufzunehmen. In beeindruckenden Szenen, die erschütternde Armut und Massenarbeitslosigkeit einfingen, schufen er und sein Kameramann Bilder, die, sicherlich durchaus im Sinne des NS-Regimes, die dramatischen Schattenseiten der von zahlreichen Auswanderungswilligen als ‚Gelobtes Land‘ gepriesenen USA dokumentierten.[5] Dieser vermeintlich seelenlosen Gesellschaft, deren Werte sich in Trenkers Film ausschließlich nach Dollar und Cent ausrichten, stellt der Regisseur zu Beginn und zum Ende hin traumverloren schöne Bilder winterlich verschneiter und festlich illuminierter Alpenlandschaften entgegen, die wiederum zu insinuieren suchen, dass die vertraute Heimat mit ihren schlichten aber ehrlichen Menschen der (menschlich) kalten Fremde im Großstadtdschungel vorzuziehen sei.
Der Internetauftritt der Filmzeitschrift Cinema befand: „Trenkers Film versinnbildlicht durch den Kontrast der Häuserschluchten Manhattans zu der majestätischen Dolomiten-Bergwelt die Verlorenheit des Einzelnen“ und nannte Der verlorene Sohn ein „Meisterwerk vom Tiroler Autorenfilmer“[9]
Diese und weitere Informationen standen mir 1988 zur Verfügung, als ich den Film angeschaut hatte, aber den Sinn des Stadt-Berg-Konstrastes zu erfassen, war nicht so schwierig, allein die religiöse Dimension blieb mir vielleicht ein wenig verborgen. „Der verlorene Sohn“ gilt vielen als das beste Werk von Luis Trenker, den man als frühen Autorenfilmer des Tonzeitalters bezeichnen kann. Im Grunde sind diese Filme auch Vorläufer der späteren Heimatfilme, die aber nicht mehr so pathetisch wirken und nicht so ehrlich vorgetragen, sondern, nach den ersten Erfolgen des Nachkriegsgenres, ziemlich berechnend und durchschnittlich, während „Der verlorene Sohn“ große Stärken und einige Schwächen aufzuweisen scheint. Er wird zum Beispiel, besonders die „Hungerszene“, tatsächlich als ein Vorläufer des Neorealismus angesehen.
Und eines müssen wir hier für alle deutschen Filme aus der Zeit von 1933 bis 1945 festhalten, von denen wir diesen als ersten besprechen: Bis auf wenige Ausnahmen, die sich aufgrund außergewöhnlicher Popularität eine gewisse Unabhängigkeit bewahren konnten, sind diejenigen, die damals Filme machten, entweder aus Überzeugung, aus Opportunismus oder weil sie sich den Sprung in eine andere Kultur nicht trauten und nicht jüdisch waren, diesen Schritt also nicht gehen mussten, um zu überleben, heute als in unterschiedlichen Stufen als belastet einzuordnen. Dass es dabei immer wieder, wie man in der Trenker-Biografie-Seite der Wikipedia nachlesen kann zu Wendungen und unterschiedlich zu wertenden Einlassungen kam, liegt gerade bei jenen, die keine ausgewiesenen Nazis waren, auf der Hand. Nicht nur in der Kunst war es unmöglich, sich zu widersetzen und nicht mindestens ein Berufsverbot dafür zu kassieren, aber dort besonders schnell, weil alles, was produziert wurde, einer rigiden Zensur unterworfen war. Das Medium Film als Steckenpferd u. a. von Joseph Goebbels, der dieses Medium nach der Machtergreifung kontrollierte, stand aufgrund seiner Massenwirksamkeit dabei besonders im Fokus.
Off topic or not
Schon beim dritten Film, der in „Das internationale Filmverzeichnis Nr. 8“, Kapitel 2, „Deutschland“ beschrieben wird, sind wir im Jahr 1934 angelangt und damit in der Nazi-Zeit. Deswegen betreiben wir gleichzeitig die Aufarbeitung der späten 1910er und 1920er Jahre in unserer großen Stummfilm-Retrospektive vornehmen. Die Filme müssen allerdings fast alle neu oder wieder gesichtet werden, um Texte über sie auf dem Filmfest vorzustellen, bevor wir mit Rezensionen, die ab dem Jahr 2011 für den ersten Wahlberliner geschrieben und nur teilweise veröffentlicht wurden, etwas stärker vor allem in die frühen 1930er einstiegen. Auf diese Weise entsteht, anders als bei Kapitel „1“ (USA), nicht erst mit der Zeit, sondern von Beginn an ein großer Gap zwischen den beiden chronologischen Schienensträngen, denen wir folgen. Eine weitere Quelle haben wir bisher nicht angetastet: gelagerte Filme, die von den 1990ern bis Mitte der 2000er auf VHS aufgzeichnet wurden. Wir verfügen nicht mehr über ein funktionsfähiges Gerät und denken darüber nach, in einer ersten Nacharbeitungsphase ein „refurbishtes“ Exemplar zu erwerben, solche gibt es nämlich noch zu vernünftigen Preisen, während neue VHS-Videorecorder nicht mehr hergestellt werden.
Der Hintergrund der idee ist, dass in jenen Jahren im Fernsehen noch viele Filme gezeigt wurden, die komplett aus den Programmen verschwunden sind, insbesondere eben Vorkriegsfilme bzw. solche aus der Zeit bis 1945. Sie werden heute von der F.-W.-Murnau-Stiftung verwaltet, sind aber nicht alle frei zugänglich und müssten teilweise mit einigem Aufwand beschafft werden. Damit sind nicht die Vorbehaltsfilme gemeint, die im Fernsehen nie gezeigt wurden und nur unter besonderen Bedingungen gesichtet werden können. Nach Corona, also eines fernen Tages, wird es vielleicht seitens des Kunstkinos „Babylon“ in Berlin eine Retrospektive geben, die sich auf breiterer Basis den deutschen Filmen der 1920er und 1930er widmet und nicht im Wesentlichen, wie mit allerdings überragender Hingabe, „Metropolis“, den wir selbstverständlich auf dem Filmfest vorstellen werden.
© 2021, 1989 Der Wahlberliner, Thomas Hocke
Kursiv: Wikipedia
| Regie | Luis Trenker |
| Drehbuch | Luis Trenker, Arnold Ulitz, Reinhart Steinbicker |
| Produktion | Paul Kohner |
| Musik | Giuseppe Becce |
| Kamera | Albert Benitz Reimar Kuntze |
| Schnitt | Waldemar Gaede Andrew Marton |
| Besetzung | |
|---|---|
|
|


