Filmfest 140 A
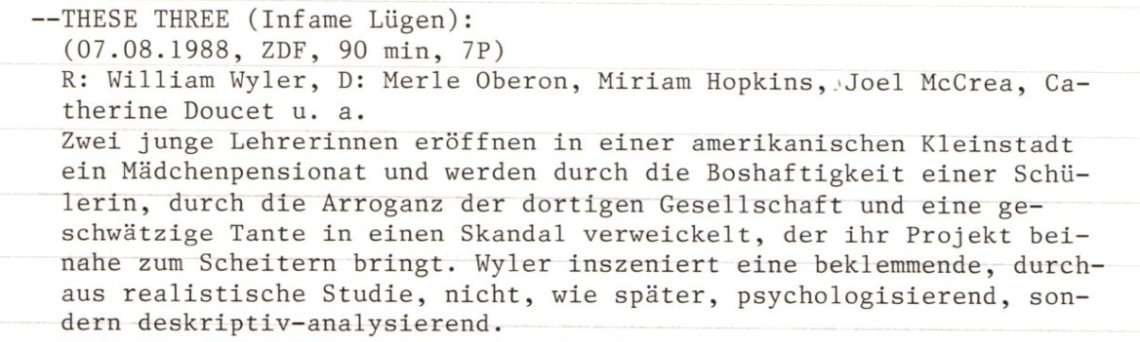
 Ein wenig schmunzeln muss man auch mal dürfen, wenn man alte Rezensionen liest und sich sogar traut, sie wiederzuveröffentlichen.
Ein wenig schmunzeln muss man auch mal dürfen, wenn man alte Rezensionen liest und sich sogar traut, sie wiederzuveröffentlichen.
Mit „nicht psychologisierend, sondern deskriptiv-analysierend“ ist eher gemeint: Beschreibend, nicht, dass sich die Figuren, wie es in den 1960ern üblich geworden war, sich selbst erklären und man bei dem, was man sieht und hört, zwischen deren Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung unterscheiden muss, die man als Betrachter hat. Der Film noir ist aus vielen Gründen eines meiner Lieblingsgenres. Einer davon ist, dass diese Differenzierung vermehrt ins Kino fand, als Figuren anfingen, auch als Narratoren tätig zu werden und ihr eigenes Schicksal zu reflektieren, inklusive einem bestimmten, oft fatalistischen Ton, den man als Außenstehender nicht unbedingt als zwingend ansehen muss, weil er auf die Unterwerfung unter die „Vorbestimmung“ abzielt. Derlei gab es in den 1930ern in der Regel noch nicht, aber Regisseur William Wyler hatte es immer schon verstanden, packende Figuren zu etablieren, die durch ihr Handeln und ihr Verhalten kenntlich sind.
Als Nr. 134 des Filmfests hatten wir die „Alt-Rezension“ zu „Dodsworth“ („Zeit der Liebe, Zeit des Abschieds“) wiederveröffentlicht. „Dodsworth“ war einer der beiden Filme, mit denen Wyler Aufmerksamkeit erregte, der andere, kurz zuvor gedreht, war „These Three“. Obwohl die letzte Sichtung dieses Films lange her ist, erinnere ich mich gut daran, wie beeindruckend ich vor allem die Darstellung von Bonita Granville als boshafte 12-jährige Mary fand. Eine Kinderfigur, die man wirklich hassen kann, ist in jenen Jahren, in denen Shirley Temple versuchte, das depressionsgeplagte Amerika mit einem optimistischen Strahlen zu beglücken, eine absolute Ausnahme – zumindest in der Form, dass jemand richtiggehend „psycho“ ist – und im Grunde ist das bis heute so geblieben, Kinder als zentrale Figuren betreffend. Aber „These Three“ ist auch kein Kinder- und Familienfilm, sondern tatsächlich ein frühes Psychodrama.
Dass man das Thema lesbische Liebe in dem Film nicht in den Vordergrund gestellt hat, ist den Umständen der Zeit zu verdanken:
Durch den Hays Code, dem zufolge eine Behandlung des Themas Homosexualität verboten war, sah sich Produzent Samuel Goldwyn gezwungen, das Drehbuch umschreiben zu lassen. Aufgrund des Bekanntheitsgrads des Bühnenstückes war es unmöglich, den Titel des Stücks als Filmtitel zu verwenden.[2] Erst 1961 konnte William Wyler das Bühnenstück mit der Originalhandlung und dem Originaltitel drehen. In Deutschland erschien der Film unter dem Titel Infam, die Hauptrollen spielten Audrey Hepburn, Shirley MacLaine und James Garner. Miriam Hopkins, die in dem Film von 1936 in der Rolle der Martha Dobi zu sehen ist, spielte Tante Lily. (Wikipedia)
Ich kenne den Film aus dem Jahr 1961, nach meiner Ansicht ist „das Thema“ auch in ihm nicht vollkommen offen gezeigt worden, vermutlich ist das aber auch im zugrundeliegenden Stück nicht so. Zwar wurde der Hays Code oder Production Code im Laufe der Jahre aufgeweicht, aber prinzipiell galt er bis 1967. Darauf, dass man auch 1961 noch vorsichtig war, deutet dieser Absatz in der Wiki-Biografie der Autorin des Stückes, Lilian Hellman, hin, die auch das Drehbuch für die 1936er Filmversion verfasste.
Wyler verfilmte das Stück 1961 mit namhaften Schauspielern wie Audrey Hepburn, Shirley MacLaine und James Garner erneut, wobei das Thema auch nahezu 30 Jahre nach der Uraufführung des Bühnenstückes noch provokant genug blieb, um auch in dieser Fassung keine explizite Erwähnung zu finden. (Wikipedia)
Der zentrale Punkt könnte allerdings, wie es weiter heißt, tatsächlich die Dekonstruktion des kulturromantischen Mythos vom grundsätzlich unschuldigen Kind gewesen sein – anhand der Figur Mary Tilford, der kleinen „Machiavellistin“. Heute dürfte es nicht mehr so streitig sein, dass wir alle von Beginn an gute und weniger gute Eigenschaften in uns tragen und das Umfeld vor allem die Aufgabe hat, die guten Eigenschaften zu fördern, die negativen nicht zur sehr zur Entfaltung kommen zu lassen – und nicht, wie im neoliberalen Zeitalter üblich geworden, genau das Gegenteil zu tun und damit eine rüde Gesellschaftsform zu erschaffen, die von empathie- und skrupellosen Psychopath*innen beherrscht wird.
© 2020, 1989 Der Wahlberliner, Thomas Hocke
| Regie | William Wyler |
| Drehbuch | Lillian Hellman |
| Produktion | Samuel Goldwyn |
| Musik | Alfred Newman |
| Kamera | Gregg Toland |
| Schnitt | Daniel Mandell |
| Besetzung | |
|---|---|
|
|


