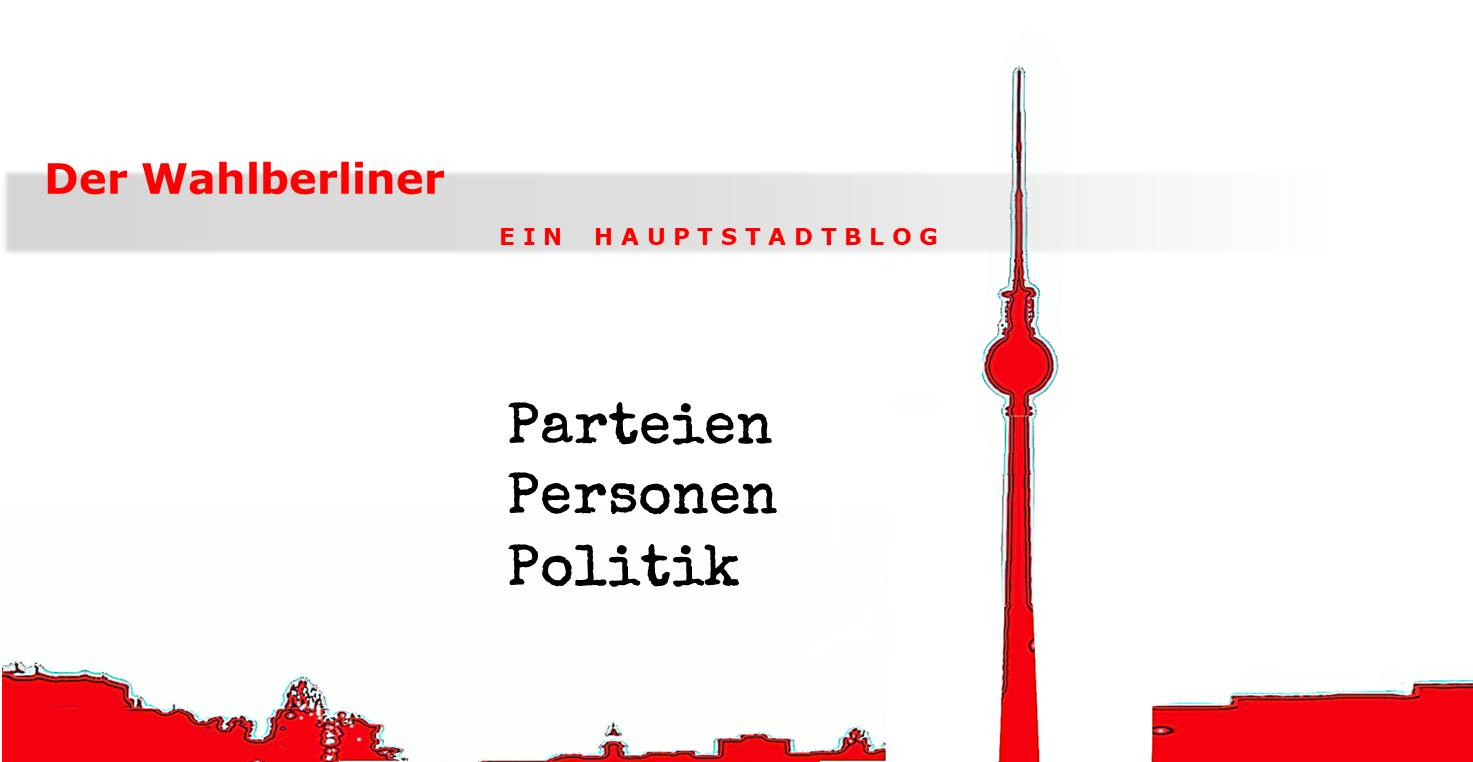Frontpage | Politik, Personen, Parteien | Die Linke, Oskar Lafontaine
Wir könnten die heutige Nachricht vom Rückzug Oskar Lafontaines von allen politischen Ämtern lapidar in dieser Form abhandeln: Wir von uns vorausgesehen, ohne Insiderwissen. In einem Artikel, der sich mit Corona befasste, aber auch in dieser Diskussion mischen Oskar Lafontaine und besonders seine Frau Sahra Wagenknecht bekanntlich mit. Aber für uns ist dazu mehr zu schreiben.
Oskar Lafontaine war der Politiker, welcher maßgeblich unser Bild von linker Politik in unserer Jugendzeit bestimmt hat, da wurde er nämlich Ministerpräsident unseres Heimat-Bundeslandes. Auch das haben wir im verlinkten Artikel angedeutet: Ein Grund, sich der SPD anzunähern, war Lafontaine für uns eher nicht. Die meisten Saarländer:innen sahen das anders und Lafontaine schaffte, was außerhalb von Bayern sehr selten war und heute beinahe unmöglich erscheint, nämlich absolute Mehrheiten zu gewinnen. Er verweist jetzt auf die Politiker:innen der Linken, die nach seiner Ansicht keine Wahlkämpfe gewinnen können. Da ist insofern etwas dran, als Lafontaine einer der besten Wahlkämpfer der letzten Jahrzehnte war, parteiübergreifend. So jemanden wird die Linke nicht so schnell wieder bekommen. Zusammen mit Gregor Gysi erzielte er das bisher einzige zweistellige Wahlergebnis für die Linke: Bei der Bundestagswahl 2009 kam die aus der WASG und der PDS zusammengeführte Partei auf 11,9 Prozent der Zweitstimmen. Begünstigt sicher auch durch die Bankenkrise und den Wirtschaftseinbruch jenes Jahres, aber die Einflussgrößen lassen sich so genau nicht messen, die beiden „Leitwölfe“ zogen, das ist unzweifelhaft. Bis dahin war es ein weiter Weg.
In den 1970ern machte Lafontaine zunächst als Oberbürgermeister von Saarbrücken von sich reden, bevor er 1985 Ministerpräsident wurde. Gegen einen recht schwachen CDU-Kandidaten, aber es war ein Kantersieg in einem Land, das zwar industriell geprägt war und eine große Arbeiterschaft hatte, aber auch sehr katholisch war und daher vor allem auf dem Land sehr konservativ tickte. Die einzige Großstadt, die hatte in den 1970ern schon etwas mehr linkes Potenzial und sie war die ideale Ausgangsbasis für Lafontaine. Es folgte seine Aufbauphase, die unter anderem dazu führte, dass in der Stadt ein historisches Rotlichtviertel saniert wurde und nach wenigen Jahren überregional für seine hochwertige Gastronomie und seine kleinen, feinen Shops bekannt war.
Als Lafontaine 1985 Ministerpräsident wurde, packte er die Menschen an der Saar direkt beim Nerv: Was wird aus Kohle und Stahl, unserem Brot, unserem Stolz? Lafontaine schaffte es, die damalige SPD-Mehrheit im Bundesrat auszunutzen, um die Bundesregierung geradewegs zu erpressen. Das bereits finanziell in Not befindliche Saarland wurde teilentschuldet und Lafontaine konnte immer wieder Subventionen für die Traditionsbranchen des Landes herausschlagen. Wer sich dabei ans Ruhrgebiet und dessen bis heute nicht abgeschlossene Konversion erinnert fühlt, liegt nicht falsch, die Strukturen und auch die Mentalität der Menschen sind einander nicht unähnlich. Nun ist NRW nicht nur das Ruhrgebiet, so, wie das Saarland nicht nur aus Bergbau und Stahlwerken bestand.
Zum Beispiel hatte die vorherige CDU-Regierung bereits erfolgreich die Autoindustrie als neuen großen Arbeitgeber an Land gezogen, der heute noch die industrielle Basis des Landes bildet. Die größten Einheiten werden von Ford in Saarlouis und ZF in Saarbrücken betrieben, auch die Deutschland-Zentrale von Peugeot, heute Stellantis, befindet sich dort und immer noch werden dort viele Autos der Marke Peugeot gefahren. Viele Zulieferer haben sich um die Werke herum angesiedelt.
Das hätte eine Erfolgsstory werden können, doch nicht mit Oskar Lafontaine. Der Bau des Daimler-Smart-Werks im Saarland stand als nächste große Investition im Raum, aber Lafontaine ließ die Chance, vorsichtig ausgedrückt, an sich vorüberziehen und trotz der im Saarland vorhandenen Infrastruktur setzten die Schwaben ihren Kleinstwagen-Ableger lieber in die französische Pampa, nach Hambach. Die Treue der Saarländer:innen zu ihrem kleinen Napoleon, dem Oskar, hielt dennoch an, denn er versprach die ewige Kohle und den ewigen Stahl, auch wenn jeder Arbeitsplatz am Ende dieser Ära mit 100.000 DM jährlich subventioniert werden musste. Dass diese Strategie nicht zukunftsfähig war, wussten kluge Köpfe längst, aber Lafontaines Wahlkampfmaschine, angetrieben von seinen erfolgreichen Einwirkungen auf die Bundesregierung (wollt ihr unsere Zustimmung im Bundesrat, für was auch immer, gebt uns Kohle!), rollte von Sieg zu Sieg. Uns war diese Methode, das Saarland über Wasser zu halten, eher peinlich. Das einzige, was in Lafontaines Zeit neu entstand, waren, knapp berichtet, ein kleines IT-Industriegebiet in Saarbrücken und einige interessante Institute für die Universität des Saarlandes, aus denen heraus auch Unternehmensgründungen erfolgten. Arbeitsplatzmäßig war das bei Weitem zu wenig, um den Verlust in den Großindustrien auffangen zu können. Heute sind die meisten dieser Neugründungen nicht mehr selbstständig und haben nicht zu wertvollen Konzernsitzen im Saarland geführt. Außerdem sind sie dem Land teilweise von der EU mit Strukturwandel-Beihilfen geradezu aufgedrängt worden, da hätten Lafontaine und sein Spezi und Nachfolger Reinhard Klimmt schon gezielt nein sagen müssen, um sie zu verhindern.
Hätten nicht viele junge Menschen dem Saarland den Rücken gekehrt, auch während der Zeit von Oskar Lafontaine, wäre die Bevölkerung nicht rückläufig, hätte das Saarland als Bundesland wohl nach Bremen die zweithöchste Arbeitslosenquote im Westen, sie wäre auch höher als die Quoten in Sachsen oder Brandenburg. Das ist auch eine Folge von Lafontaines verfehlter Wirtschaftspolitik, denn anders als im Ruhrgebiet hatte man an der Saar in den 1970ern, vor seiner Zeit und unter dem ähnlich beliebten CDU-Ministerpräsidenten Franz-Josef Röder, die Zeichen der Zeit gesehen und mit dem Umbau begonnen. Es ist aber so verführerisch, den verunsicherten Menschen zu erzählen, es werde niemals zu einem Wandel kommen und alles bleibt, wie es ist. Besonders jener Typ, der in großindustriellen Strukturen aufgewachsen und politisch stark an Gewerkschaften und Parteien orientiert ist, tendiert dazu, solche Erzählungen dankbar anzunehmen. Gute Realpolitik lässt sich auf diese Weise mit rhetorischer Kraftmeierei und einer rüden, unkooperativen Art gegenüber der übergeordneten politischen Ebene ersetzen und so lief es weitgehend unter dem Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine. Die Kenndaten des Saarlands verschlechterten sich kontinuierlich, in Relation zum übrigen Westdeutschland. Von einem Zwischenhoch zu Beginn der 2000er unter dem neuen CDU-Ministerpräsidenten Müller abgesehen, hält dieser Trend bis heute an. Aufgrund der Wiedervereinigung und der gigantischen Herausforderungen, die mit ihr einhergingen, fiel es jedoch nicht mehr auf, dass es im Westen ein Bundesland gab, das ebenfalls den Anschluss noch nicht vollständig geschafft hatte. Bekanntlich kam das Saarland erst am 1.1.1959 wirtschaftlich zur BRD, der erste für die Menschen spürbare Effekt war eine erhebliche Absenkung der Reallöhne.
Sieben Jahre später trat Oskar Lafontaine in die SPD ein. Seine Wirkung in der Bundespartei ist bekannt, sie ist von Aufstieg, unerwarteter Übernahme des Parteivorsitzes, von der Wahlniederlage 1990 und dem späteren Austritt geprägt und jüngst hat Lafontaine bekundet, es war wohl keine so gute Idee, wegen Schröder hinzuwerfen. Finden wir auch. Darin zeigte sich nämlich das Muster, das jetzt auch für sein Verhalten in der Linken gilt. Deshalb ist alles, was er selbst als Gründe für seinen Rückzug benennt, mit Vorsicht zu genießen. Auch in der SPD hätte es Möglichkeiten gegeben, Schröder standzuhalten, denn der linke Flügel stand hinter Lafontaine. So, wie viele in der Linken immer noch eine starke Affinität zu ihm und seiner Frau Sahra Wagenknecht aufweisen. So, wie er seinerzeit viele in der SPD im Stich gelassen hat, gibt er jetzt denen, die ihm vertrauen, eins mit und auch seine Frau zeigt dieses Verhalten. Die beiden sind sich zu gut, um mit anderen auf Augenhöhe und unter Inkaufnahme des alltäglichen Kleinklein, das eine Kaderpartei nun einmal kennzeichnet, Führungsarbeit zu leisten, das steckt wohl eher hinter den Niederlagen und Rückzügen, als dass zum Beispiel das Programm der Partei zu wenig seine oder ihre Positionen berücksichtigen würde.
Das Programm hat sich in den letzten Jahren nicht so sehr verändert, dass die z. B. bei der Bundestagswahl 2017 durchaus noch als angemessen empfundenen Inhalte nun vollkommen zulasten des Lafontaine-Wagenknecht-Flügels verschwunden wären. Ja, es gab Verschiebungen, zum Beispiel in Sachen Migrations- und Gesellschaftspolitik, aber das Wesentliche an diesem Programm ist nach wie vor, dass es ohne Systemveränderung nicht umgesetzt werden könnte (wohl aber im Rahmen der FDGO). Dass sein Modus nicht die Programmatik der Linken alleine bestimmen wird, wusste Lafontaine von Beginn an, denn die PDS war nun einmal der stärkere, ältere, strukturiertere Partner, als der Zusammenschluss erfolgte, und mit sie hatte viele „Strömungen“ im Gepäck. Diese sind in der Tat durch die Art, wie sie die Partei segmentieren, nicht immer vorteilhaft, z. B. wegen des Postengeschachers nach Proporz, aber es gibt Integrationsfiguren wie Dietmar Bartsch, die es bisher geschafft haben, dass es nicht zu einer Spaltung kommt. Lafontaine konnte hingegen nie integrieren, sondern fühlte sich immer dann wohl, wenn er alleine das Sagen hatte. Da blühte er auf und man vergaß seine duchwachsenen realen Leistungen, wenn er voll auf Wahlkampf-Adrenalin war. Dadurch, dass seine Frau Sahra Wagenknecht Mit-Fraktionsvorsitzende der Linken wurde, ließ sich die Lagerbalance nach seinem turnusgemäßen, planmäßigen Rückzug vom Co-Parteivorsitz einigermaßen aufrechterhalten, aber viele Funktionär:innen kamen aus dem Osten und waren anders orientiert, obwohl Wagenknecht selbst aus der KPF stammt (der kommunistischen Plattform innerhalb in der Linken, zuvor ein Zusammenschluss innerhalb der PDS). Aber die KPF ist nicht die einflussreichste der Strömungen, sondern es sind eher jene, die man als „Reformsozialisten“ zusammenfassen kann.
Außerdem liegt in Lafontaines Programmkritik eine für ihn nicht ganz untypische Volte: Er war immer ein Sozialdemokrat, niemals Sozialist. Die sozialistischen Bestandteile des Programms der Linken stammen eher von der PDS als von ihm. Er hat in seiner „West-Zeit“ zwar mit einigem Sachverstand Auswüchse des Kapitalismus kritisiert, aber nie das System infrage gestellt, in dem er groß geworden war und das ihm einige Erfolge ermöglichte. Es ist das Erbe der PDS, das noch einen Hauch von Systemveränderungsanspruch durch die Programmatik der Linken wehen lässt.
Nach unserer Ansicht steckt Lafontaine zu einem guten Teil hinter der Gründung der „Bewegung von oben“ namens „Aufstehen“ im Jahr 2018, die seine Frau eine Zeitlang angeführt hatte. Aber auch von diesem Engagement zog sie sich zurück und wir hatten frühzeitig analysiert, dass es beim Aufbau desselben zu erheblichen Fehlern gekommen war, sowohl die Thematik als auch die Ausrichtung betreffend. Anders ausgedrückt. Nur als Gefahr einer Liste Wagenknecht oder als tatsächliche Abspaltung von der Linken hätte diese Initiative damals Erfolg haben können und sie hätte sich ein zentrales Thema geben müssen. Wir empfahlen in einigen Artikeln die Wohnungsfrage. Diese Frage, die jeder, der die Stadt Berlin ein wenig von der sozialen Seite analysierte, als das Ding in Berlin kommen sah, wurde mittlerweile von „DWenteignen“ mit einer beispiellos guten Kampagne besetzt.
Strategisch und wenn er sich gegen starke Gegner behaupten muss, wenn Neues umgesetzt werden soll, ist Lafontaine nicht so gut, wie manche ihn sehen. Da fehlt es in der Tiefe an Festigkeit, um die ganz großen Ziele zu erreichen, zum Beispiel Bundeskanzler zu werden und nicht nach einem gescheiterten Versuch, der in der damaligen Lage, der plötzlichen Wiedervereinigung, für die Lafontaine nicht die richtigen Worte fand und die ihm sichtbar das Konzept verhagelte, scheitern musste, den Stab an einen so unfähigen Politiker wie Rudolf Scharping zu übergeben. 1998 hätte er ebenso wie Schröder eine Chance gehabt, gegen die abgewirtschaftete Kohl-Regierung zu gewinnen.
Damals hatte sich schon herausgestellt, dass viele seiner Warnungen berechtigt waren und dass er 1990 keine Alternative anzubieten hatte, wäre nach den Jahren der Kohl-Elegie, dessen letzter Amtszeit von1994 bis 1998, nicht mehr thematisiert worden. Vielleicht hätte es mit Lafontaine den folgenden sozialen Kahlschlag nicht gegeben, aber diese Chance hat er sich und der Bevölkerung ja genommen, indem er in der wichtigen Position des Finanzministers viel zu schnell aufgab. Es war die einzige, mit welcher man Kanzler Schröder hätte wirklich piesacken können, aber dazu hatte Lafontaine nicht den Nerv. Es ist das Sich-Durchsetzen gegen erheblichen Widerstand, um dann konstruktiv etwas im Sinne der Bevölkerungsmehrheit bewirken zu können, das Lafontaine im Grunde immer gefehlt hat. Dabei musste ihm doch klar sein, dass das Kapital ihm als nicht gerade dem neoliberalen Zeitgeist huldigenden Links-Keynesianer ebenjenen Widerstand entgegensetzen wird, sobald er als Bundespolitiker mehr Einfluss haben würde, und sei es in der Person des Genossen der Bosse. Persönlichkeitsstrukturell wirkt sich das heute so aus:
Zudem kritisierte er die Bundesspitze für den Umgang mit den Parteiausschlussverfahren gegen ihn selbst und seine Ehefrau Sahra Wagenknecht. Den Bundesvorstand scheine es nicht zu stören, wenn „irgendwelche Leute“ mitten im Wahlkampf Ausschlussanträge stellten.
Keine Frage, mitten im Wahlkampf ein Ausschlussverfahren, das haut rein. Aber wodurch kam es? Weil Sahra Wagenknecht mitten im Wahlkampf oder im Vorwahlkampf ein Buch veröffentlichte, in dem ihre Partei wirklich schlecht wegkommt und sie erzielte als Spitzenkandidatin in NRW ein so mageres Wahlergebnis, dass man daraus nicht schließen kann, dass ihre Kritik bei den Wähler:innen auf große Resonanz gestoßen ist. Dafür ist sie eben Bestsellerautorin. Manchmal kann man nicht alles haben und es ist naiv zu glauben, dass eine ohnehin in Schwierigkeiten befindliche Partei großzügig über solche Angriffe hinwegsehen kann. Im Gegenteil, einigen kam dies alles gerade recht, und das merkte man an gewissen Vorgängen in den sozialen Medien, wie dem Herausgreifen einzelner, besonders als Aufreger dienlicher Passagen noch vor der offiziellen Vorstellung des Buches.
Dass die heutigen Parteivorsitzenden Janine Wissler oder gar Susanne Hennig-Wellsow nicht an die Publikumswirksamkeit von Wagenknecht und Lafontaine heranreichen, ist klar, aber die Linke ist in manchen Dingen schlicht zu dogmatisch: Bei der dünnen Decke an Spitzenpersonal darf man nicht turnusmäßig rotieren, das führt bloß dazu, dass weitgehend unbekannte Gesichter durch noch weniger bekannte ersetzt werden und die Wähler:innen die wichtige Identifikation mit diesen Personen nicht hinbekommen. Wir sind keine Fans von Personenkult, aber es geht um Vertrauen, um Kompetenz, und da fällt die Linke derzeit gegenüber allen anderen Parteien, die auch nicht gut dastehen, noch einmal erheblich ab. Dieses Durchwechseln ist keine Erfindung von Lafontaine und Wagenknecht, im Gegenteil, die beiden würden sicher heute noch gerne die Geschicke der Partei bestimmen. Aber man kann sich nicht auf den Standpunkt stellen, man sei aufgrund seiner immer richtigen Positionen und ebenjener Wirkung nicht angehalten, sich mit der übrigen Partei zu verständigen. So funktioniert Kaderparteipolitik nicht. Das sollte Lafontaine aufgrund seiner SPD-Erfahrungen längst wissen.
Doch wenn es gewisse Erfolgshindernisse in einer Persönlichkeit gibt, die nicht dazu geführt haben, dass jemand komplett abschmiert und sich zwecks Erarbeitung einer Überlebensstrategie unbedingt hinterfragen muss, sondern trotz vieler Fehler noch viel Zuspruch bekommt, dann kommt es eben nicht zu einer Justierung jener eigenen Persönlichkeit und man endet, wie Lafontaine, auch ein wenig als traurige Figur, die (abermals) in die Regression geht, anstatt sich in Würde zu verabschieden und der Partei in dieser schwierigen Zeit noch ein wenig zu helfen, ganz uneigennützig.
Hat nun seine Frau noch eine Chance? In der Linken eher nicht. Wenn doch, dann wäre es ein Notruf, Eingeständnis der totalen Unfähigkeit der jetzigen Führungsriege oder ein Swing der Partei, den wir aber derzeit nicht absehen, dazu dominieren die Wagenknecht-Gegner:innen intern zu sehr. Nachdem Lafontaine sich wohl auch nicht getraut hat, sie mit „Aufstehen“ von der Linken zu trennen: Jung genug für eine eigene Liste wäre sie noch. Aber ist dazu nach einem Ausfall wegen Burnout vor zweieinhalb Jahren noch die Kraft vorhanden und wird sie davon Abstand nehmen, sich ihr Publikum vor allem in der rechten und der Schwurbler:innen-Ecke zu suchen? Lafontaine war eine wichtige Persönlichkeit in der deutschen Politik der letzten Jahrzehnte, aber seine Vita erzählt uns auch davon, warum die Linke und die SPD heute so schwach dastehen. Dieser Prozess begann gewiss nicht damit, dass man in den letzten Monaten nicht genug auf ihn hörte, sondern bereits vor vielen Jahren, als er nicht mehr an vorderster Front helfen wollte, es zu verhindern.
TH